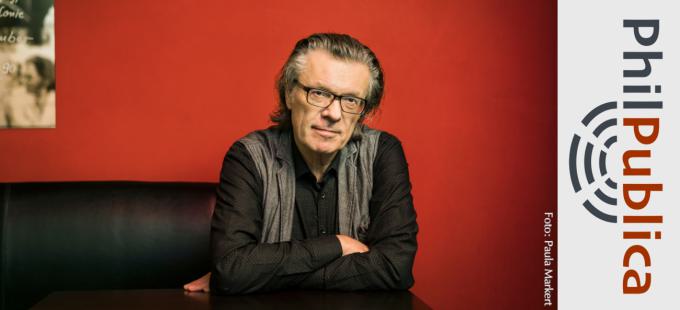Was ich noch sagen wollte
PhilPublica stellt vor

Konrad Paul Liessmann
Was war Ihr erster Kontakt mit der Philosophie?
Im elterlichen Bücherschrank stand ein populärwissenschaftliches Buch mit dem ansprechenden Titel „Du und die Philosophie“. Schon als 13jähriger konnte ich die Finger nicht davon lassen, auch wenn ich wenig verstand. Aber ich habe mich durchgebissen. Ich wollte mehr verstehen. Nebenbei ein schönes Beispiel dafür, dass die moderne Pädagogik mit dem Grundsatz, dass man die Jugendlichen dort abholen müsse, wo sie stehen, in die Irre geht. Das Buch hat mich nicht abgeholt – aber mir einen manchmal durchaus beschwerlichen Weg gewiesen.
Welcher philosophische Text hat Ihr Leben verändert?
Sören Kierkegaards „Entweder – Oder“. Aus der Lektüre und Auseinandersetzung mit diesem Buch entstand meine frühe „Ästhetik der Verführung“, mit der ich als philosophischer Schriftsteller debütierte. Auch meine erste große Vorlesung als junger Dozent widmete sich Kierkegaard und trug den Titel „Angst, Verzweiflung, Einsamkeit“. Der Hörsaal war brechend voll.
Woran arbeiten Sie gerade?
An einer Philosophie der Krise.
Was ist Ihr Lieblingszitat?
„Überzeugungen sind gefährlichere Feinde der Wahrheit als Lügen“. Es stammt, wie könnte es anders sein, von Friedrich Nietzsche.
Was ist Ihre philosophische Lieblingsanekdote?
Diese hat mir Günther Anders, dem ich viel verdanke, selbst erzählt: Anders war in jungen Jahren, noch unter seinem eigentlichen Namen Günther Stern, Assistent bei Edmund Husserl gewesen. Dem Professor war zu Ohren gekommen, dass sich sein Assistent lebenslustig auf Bällen vergnügt haben soll. Er stellte den jungen Mann zur Rede. Auf dessen verwunderte Frage, was denn am Tanzen so schlimm sei, habe Husserl apodiktisch geantwortet: Ein Phänomenologe tanzt nicht. An diese Maxime, die wohl auch für Philosophen schlechthin gilt, habe ich mich gehalten – bis heute.
Welcher Ihrer Texte liegt Ihnen besonders am Herzen?
Mein Buch „Alle Lust will Ewigkeit. Mitternächtliche Versuchungen“ (Wien: Zsolnay 2021). Es war immer schon mein Traum gewesen, Nietzsches „Mitternachtslied“ aus „Also sprach Zarathustra“, das unvergleichlich mit „Oh Mensch! Gib Acht!“ beginnt und aus nur 11 Zeilen besteht, ein ganzes Buch zu widmen – angeregt durch Gustav Mahlers kongenialer Vertonung dieser Verse im 4. Satz seiner Dritten Symphonie.
Auf welche nichtphilosophische Leistung in Ihrem Leben sind Sie stolz?
Auf meine Touren mit dem Rennrad über Alpenpässe: Sella Ronda, Stilfserjoch, Großglockner
Was außerhalb der Philosophie hat Sie am meisten geprägt?
Die Literatur. Es gab eine Phase in meinen Leben, da wäre ich gerne Schriftsteller geworden. Ich habe meine Freunde, zum Beispiel Michael Köhlmeier oder Robert Menasse, die Romane und Erzählungen geschrieben haben, immer darum beneidet, frei erfinden zu können und sich nie der Kraft eines Argumentes beugen zu müssen.
Was ist Ihre déformation professionnelle?
Ich kann nicht anders, ich muss bei allen Begriffen, die mir der Zeitgeist entgegenspült, darüber nachdenken, was sie ursprünglich bedeutet haben und wie sie heute verwendet werden. Das ist mitunter sehr ernüchternd. Ich bin, nebenbei, eher dafür, diese Bedeutungen nicht auszudehnen, sondern radikal einzuschränken. Demokratie zum Beispiel ist für mich eine Herrschaftsform, in der Mehrheiten entscheiden. Alles andere ist schon zu viel Ideologie.
Soll man glauben, was die Mehrheit glaubt?
Natürlich nicht. Wahrheitsfragen und ästhetische Fragen sind nicht durch Mehrheitsbeschluss zu entscheiden. Wohl aber die Regeln des Zusammenlebens. An diese aber muss man nicht glauben, es genügt, sie zu befolgen.
Welches war die beste Literaturempfehlung, die Sie je bekommen haben?
In meinem ersten Studiensemester empfahl mir eine kluge Kommilitonin, doch „Doktor Faustus“ von Thomas Mann zu lesen. Ich befolgte den Rat. Die Ratgeberin habe ich längst aus den Augen verloren, der epochale Roman fasziniert mich noch immer und immer wieder aufs Neue.
Könnten Sie jemanden küssen, der Philosophen für Schwätzer hält?
Jederzeit! Unbedingt! Da man beim Küssen nicht reden kann, wäre doch der Kuss der beste Beweis dafür, dass Philosophen keine Schwätzer sind.