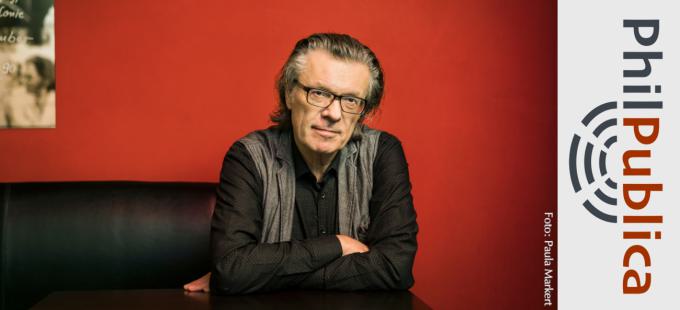Was ich noch sagen wollte
PhilPublica stellt vor

Mirjam Schaub
Was ist Ihre erste Erinnerung an einen philosophischen Gedanken?
Ein Jahr vor dem Abitur brummte uns unser Deutschlehrer, Karl Forster, einen Vergleich auf zwischen Platons Höhlengleichnis und Volker Brauns gleichnamigem Gedicht. Warum ist das Fachsimpeln über Schattenbilder nicht dem blendenden Blick in das gleißende Licht vorzuziehen? Ich las, verstand nichts, lief um den Häuserblock, las weiter, rannte noch einmal um alle Gärten. Am Ende waren zwölf Seiten eng beschrieben und ich selig und erschöpft, wie nach einer aufregenden Nacht. Ich habe heute keine Ahnung mehr, was ich damals über Platon und Braun dachte. Aber an dem Tag fand ich, so albern das klingt, meine Bestimmung. Dabei war ich fest entschlossen gewesen, Medizin zu studieren.
Welcher philosophische Text hat ihr Leben verändert?
Mit 19 wäre ich in Avignon beinahe vergewaltigt worden. Ich wurde den Mann, den ich als Straßenmusikantin während des Festivals aufgegabelt hatte, erst an der Tür los, die in eine menschenleere Wohnung geführt hätte, indem ich aufs Geratewohl über das Absurde bei Camus improvisierte, das uns beide offenkundig an dieser Straßenecke gerade ansprang. Ich redete um mein Leben. Auf Französisch. Es turnte ihn so dermaßen ab, dass er sich schließlich kopfschüttelnd trollte.
Wie halten Sie es mit der Religion?
In meiner Jugend war ich gläubig. In Rom, auf einem Polizeirevier, das wir nachts aufsuchten, um die geraubte Handtasche meiner Mutter zu beklagen, meinte ich Jesus barfuß und mit Dreadlocks neben mir auf dem Boden kauern zu sehen. Ich verlangte, den Junkie sofort zu retten. Meine Eltern schickten mich daraufhin, wiewohl ungetauft, auf eine katholische Mädchenschule, nicht des Glaubens, sondern der fehlenden Jesusse und Junkies wegen. Die Ursulinen erzürnten mich bald so sehr, dass ich mich mit 14 aus Protest gegen die Bigotterie taufen und konfirmieren ließ. Meinem Pfarrer, Manfred Henke, verdanke ich herrliche Konfirmandenfreizeiten und ungestüme Bärenjagden durch den Wald.
Von Dauer war Ihre Jugendliebe zur Religion aber nicht?
Das stimmt. Mit 20 trat ich aus der Kirche aus, nicht aus Protest gegen die Institution, sondern weil mir mein Glaube über Nacht abhandengekommen war. Je älter ich werde, desto häufiger denke ich darüber nach, wieder einzutreten. Da meine Familie mütterlicherseits von französischen Glaubensflüchtlingen abstammt, ist das vielleicht ein inter-generationelles Erbe, dem niemand entkommt? Jedenfalls sind auch meine beiden erwachsenen Töchter im Protestieren unschlagbar. Sie sagen laut und gerne Nein.
Ist es immer gut, vernünftig zu sein?
Ja, immer. Besonders, wenn man im Berliner Tiergarten in einer lauen Juninacht zu zweit dorthin geht, wo weniger Menschen sind.
Warum schreiben Sie für die außerakademische Öffentlichkeit?
Aus Neugierde, und weil es in der Akademia keine den Namen verdienende Öffentlichkeit gibt.
Über welches Thema würden Sie gern einmal schreiben und warum haben Sie es bisher nicht getan?
Erstens über Feigheit und Faulheit. Zweitens über Opportunität und Korruption. Drittens über Sinnlichkeit und Sexualität und was beide mit dem Denken über sich selbst anstellen.
Das lässt sich hören. Geht es genauer?
Das erste Thema trieb schon Kant mächtig um. Er benannte Feigheit und Faulheit als die beiden gemeinsten Hindernisse der so bitter nötigen Selbstaufklärung. Das zweite Thema ist die so logische wie abgründige Kehrseite meiner beiden Bücher über Radikalität, die von der Sehnsucht nach Unkorrumpierbarkeit und Unerpressbarkeit handeln. Das dritte Thema schließt den Kreis zur ersten Frage dieses Antwortbogens. Die Entdeckung der eigenen Lust und des eigenen Begehrens war mind blowing für mich. Ohne Sex wäre ich nie erwachsen geworden. Nichts hätte mich je zum Denken gezwungen. Die eigene Sinnlichkeit wandelt sich in jeder Lebensphase. Sie wird nie langweilig. Ich staune immer noch Bände, welche Überraschungen sie bereithält. Über alle drei Themen habe ich bislang aus Faulheit oder aus Feigheit noch nichts geschrieben.
Ist es für Ihr Denken wichtig, verschiedene Sprachen zu sprechen?
Absolut unverzichtbar. Siehe Frage 2).
Welche Philosoph:innen hätten Sie gerne privat gekannt?
Hannah Arendt und Susan Sontag.
Warum?
Arendt wegen Heidegger. Sontag wegen Leibovitz. Nein, Quatsch. Arendt wegen des Lachens über die Einfalt der Gestapo im Angesicht ihres möglichen Todes. Sontag wegen Sarajewo und ihrer Nicht-Akzeptanz des eigenen Sterbens.
Der Wert welcher philosophischen Auffassung ist Ihnen erst spät aufgegangen?
Leibniz und die Monadologie als Lehre vorbewusster petites perceptions ist mir erst nach meinem Studium aufgegangen. Jeremy Bentham und der Utilitarismus als radikale Gebrauchserfindungskunst erst vor dem »Auto-Icon«, seinem humanoiden Artefakt, das im University College of London sitzt. Dazu mehr in meinem Buch über »Radikalität und der Mut zum Gebrauch des eigenen Lebens«, das zusammen mit dem ersten Band – »Radikalität und der Riss zwischen Theorie und Praxis« – gerade im November im Felix Meiner Verlag erschienen ist.